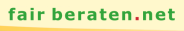Der Zugang zu den Fachinformationen exklusiv für Mitglieder und Abonnenten ist jetzt für Sie freigeschaltet.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen:
Frauenherzen schlagen anders
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Industrienationen die häufigste Todesursache - und zwar bei Männern wie bei Frauen. Dennoch werden sie häufig als typische Männerkrankheit betrachtet und in ihrer Gefährlichkeit bei Frauen stark unterschätzt.

Die medizinische Forschung hat weibliche Herz-Kreislauf-Patientinnen lange Zeit vernachlässigt. Erkenntnisse, die ausschließlich auf männlichen Stichproben beruhten, sind teilweise auf Frauen übertragen worden, ohne den möglichen Einfluss des Geschlechts zu berücksichtigen. Inzwischen wissen wir aber, dass es eine Reihe Unterschiede in Epidemiologie,geschlechtsspezifischer Klinik, Verlauf und Prognose von Herzkrankheiten gibt. Diese Erkenntnisse weisen auf die Notwendigkeit hin, präventive und rehabilitative Maßnahmen geschlechtsspezifisch zu optimieren.
 Häufigste Todesursache
Häufigste Todesursache
Nach Angaben des Statistischen Bundesamts starb im Jahr 2003 nahezu jeder Zweite durch eine Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems. Rund 90 Prozent dieser Verstorbenen waren 65 Jahre und älter. Frauen erkranken im Durchschnitt zehn Jahre später als Männer an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wobei das durchschnittliche Sterbealter bei Frauen mit 84 Jahren um 8,3 Jahre höher liegt. Die häufigste Todesursache bilden chronisch ischämische Herzkrankheiten (mangelnde Durchblutung der Herzkranzgefäße) wie koronare Herzkrankheit und Herzinfarkt. Im Jahre 2003 war dies bei knapp zehn Prozent der verstorbenen Männer und bei knapp zwölf Prozent der Frauen die Todesursache. Die Daten zeigen deutlich, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen kein männliches Problem sind, sondern für beide Geschlechter Bedeutung haben.
 Risikofaktoren für Frauen und Männer
Risikofaktoren für Frauen und Männer
Hinsichtlich der Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen lassen sich bei Frauen und Männern dieselben klassischen Risikofaktoren festmachen: Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Fettstoffwechselstörungen, Rauchen, Übergewicht und körperliche Inaktivität. Diese treten jedoch bei Männern und Frauen mit unterschiedlicher Häufigkeit auf und unterscheiden sich - teils erheblich - in ihrem Einfluss auf das Herz-Kreislauf-Risiko. Es ist bekannt, dass Männer häufiger rauchen, mehr Alkohol konsumieren und sich ungesünder ernähren. In den letzten Jahren ist allerdings eine zunehmende Annäherung der Geschlechter beobachtbar. Trotz allgemein rückläufiger Raucherzahlen, deutet ein neuer Trend auf eine Häufung weiblicher Raucher im Teenageralter hin. Da sich für Raucherinnen in Zusammenhang mit der Einnahme der Antibabypille das Risiko um das 3- bis 20-fache erhöht, ist diese Entwicklung besonders alarmierend.
Viele der traditionellen Risikofaktoren ergeben sich bei Frauen erst deutlich später als bei Männern. Beispielsweise leiden vor dem 55. Lebensjahr mehr Männer an erhöhtem Blutdruck, während sich dieses Verhältnis in höherem Lebensalter umkehrt. Insbesondere nach der Menopause kommt es bei Frauen häufiger zu einer ungünstigen Kombination von mehreren Risikofaktoren. Bei gemeinsamem Auftreten der sogenannten kardiometabolischen Risikofaktoren - Diabetes, Adipositas, Bluthochdruck und ungünstigem Lipidprofil - spricht man vom metabolischen Syndrom. Trotz bisher uneinheitlicher Klassifikationskriterien geht die Forschung davon aus, dass das kardiovaskuläre Risiko stärker erhöht ist, wenn diese Faktoren gemeinsam auftreten, als aus der Summe der einzelnen Risikofaktoren zu erwarten wäre. Das metabolische Syndrom tritt bei Männern häufiger auf als bei Frauen. Allerdings lässt sich seit einigen Jahren eine Zunahme bei jüngeren Frauen beobachten, welche insbesondere auf die steigende Fettleibigkeit zurückzuführen ist. Zudem weiß man, dass einige der kardiometabolischen Risikofaktoren wie Diabetes und Bluthochdruck bei Frauen einen wesentlich stärkeren Einfluss auf das kardiovaskuläre Risiko haben als bei Männern. So ist beispielsweise bei männlichen Diabetikern das Risiko an einer koronaren Herzkrankheit zu erkranken zweifach erhöht, während es bei Frauen mit Diabetes vierfach höher ist als das Risiko von Nichtdiabetikern.
Jüngere Studien zeigen, dass psychosoziale Risikofaktoren wie niedriger sozioökonomischer Status, Mangel an sozialer Unterstützung, soziale Isolation oder Stress am Arbeitsplatz und im Privatleben eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Herzerkrankungen spielen. Ebenso beeinflussen negative Emotionen, vor allem Depressionen und Feindseligkeit, das Risiko. Während bei Frauen insbesondere ein niedriger sozioökonomischer Status und die Doppelbelastung von Beruf und Familie das Erkrankungsrisiko erhöhen, scheint bei Männern das Stressniveau am Arbeitsplatz eine wichtigere Rolle zu spielen.
 Untypische Symptome bei Frauen
Untypische Symptome bei Frauen
In der klinischen Praxis sind Geschlechtsunterschiede bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen von allerhöchster Bedeutung. Nicht selten verzögern die eher untypischen Symptome bei Frauen die Diagnostik und tragen zu einer höheren Rate von Fehldiagnosen bei. So zeigen Frauen seltener die Symptome einer typischen Belastungsangina, bei der ein beklemmender Schmerz in der linken Brust nach körperlicher Anstrengung auftritt. Und auch die klinischen Zeichen des Herzinfarktes können bei Männern und Frauen deutlich unterschiedlich sein. Während ein männlicher Herzinfarkt mit akut auftretenden Schmerzen und Enge in der linken Brustseite, Angst, Blässe und kaltem Schweiß einhergeht, treten bei Frauen eher Atemnot, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Schwindel, ungewöhnliche Müdigkeit und Übelkeit auf. Diese unspezifischen Symptome können dazu führen, dass Anzeichen eines Herzinfarktes von den Frauen selbst, aber auch von Angehörigen nicht als solche gedeutet werden. Damit vergeht wertvolle Zeit, bis angemessene Hilfe gerufen wird, was letztendlich zu einer höheren Herzinfarkt-Sterblichkeit bei Frauen beitragen könnte.
Mit zunehmendem Wissen um die geschlechtsspezifischen Mechanismen des Erkrankungsgeschehens wächst die Frage, wie sich therapeutische Maßnahmen geschlechtsspezifisch optimieren lassen. Bisher liegen jedoch noch wenig Erkenntnisse zur Gestaltung und Umsetzung von kardiovaskulären Präventions- und Interventionsprogrammen speziell für männliche und weibliche Patienten vor. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen gilt es, Lebensstilveränderungen allerhöchste Priorität einzuräumen, um veränderbare Risikofaktoren zu vermeiden oder positiv zu beeinflussen. Hierzu zählen der Verzicht auf das Rauchen, mehr körperliche Aktivität, eine herzgesunde Ernährung sowie die Reduzierung von Übergewicht.
 Risiken geschlechtsspezifisch vorbeugen
Risiken geschlechtsspezifisch vorbeugen
Geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Veränderung des Lebensstils bestehen hinsichtlich der Motivation, der Aufnahme und Aufrechterhaltung neuer Verhaltensweisen sowie den äußeren Rahmenbedingungen. So sind beispielsweise Frauen im Allgemeinen weniger körperlich aktiv als Männer. Dabei sollte beachtet werden, dass Frauen häufiger Alltagsaktivitäten ausführen, die sportlichen Aktivitäten gleichgesetzt werden können. Frauen sind etwa bei haushälterischen Tätigkeiten oder der Kinderbetreuung mehr in Bewegung. Männern fällt es in der Regel leichter, sportlich aktiv zu werden, weil sie eher an Leistungssteigerung (Fitness) und Muskelaufbau interessiert sind. Frauen sind eher motiviert eine Gewichtsreduktion zu erreichen, Entspannungsübungen durchzuführen oder etwas für ihr allgemeines Wohlbefinden zu tun. Zudem haben Frauen, insbesondere der älteren Generation, eine geringere Sporterfahrung und fühlen sich körperlich weniger belastbar. Gemeinsames Sporttreiben mit anderen und die langsame Aufnahme von zunächst nur leichter körperlicher Aktivität kann hilfreich sein, diese frauenspezifischen Barrieren zu überwinden.
Ein konsequentes Risikofaktorenmanagement eröffnet die Möglichkeit, Entstehung und Verlauf von Herz-Kreislauf-Erkrankungen selbst positiv zu beeinflussen. Dennoch ist eine zusätzliche medikamentöse Behandlung häufig notwendig. Man weiß heute, dass es geschlechtsspezifische Unterschiede im Anwendungs- und Wirkungsspektrum vieler Medikamente gibt. Werden diese berücksichtigt, profitieren Männer und Frauen in gleichem Maße von einer konsequenten medikamentösen Einstellung der Risikofaktoren. Dennoch zeigen Studien, dass bei Frauen mit kardiovaskulären Erkrankungen seltener eine optimale medikamentöse Therapie der Risikofaktoren erreicht wird. Dies gilt insbesondere für Frauen mit erhöhten Blutfettwerten oder Bluthochdruck.
 Reha: Frauen haben andere Ausgangslage
Reha: Frauen haben andere Ausgangslage
Auch im Bereich der kardiologischen Rehabilitation gilt es, geschlechtsspezifischen Aspekten Rechnung zu tragen. Frauen zeigen eine deutlich stärkere Beeinträchtigung bei Beginn der Rehabilitation, haben mehr zusätzliche Beschwerden zur eigentlichen Grunderkrankung und leiden unter einem höheren Ausmaß an Depressivität und Ängstlichkeit. Zudem ist zu bedenken, dass aufgrund unterschiedlicher Lebenslagen von Frauen und Männern (sozioökonomischer Status, Berufstätigkeit, Familienarbeit) unterschiedliche Rehabilitationsziele bestehen. So sind Männer vor allem bestrebt wieder ins Berufsleben zurückzukehren, während Frauen eher die Stressbewältigung und Lebensstilmodifikation angehen. Erste Ansätze geschlechtssensibler Rehabilitation, zum Beispiel in Form separater Frauengruppen, werden in einzelnen Kliniken bereits angeboten.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass geschlechtsspezifische Aspekte in Grundlagenforschung, Diagnostik, Therapie, Präventions- und Interventionsprogrammen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen zunehmend Berücksichtigung finden. Dennoch ist die Datenlage für Frauen in einigen Bereichen noch immer schlecht und dementsprechend sind weitere Studien notwendig, um diese Lücken zu füllen.
Quelle: Dunkel, A.; Lehmkuhl, E.; UGB-FORUM 6/08, S. 273-276