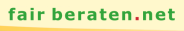Wie vegan und bio sind wir wirklich?
Die deutsche Bevölkerung isst fast ausschließlich Biolebensmittel und ernährt sich zudem vegan oder wenigstens vegetarisch. Diesen Eindruck vermitteln zumindest zahlreiche Medienberichte, Bucherscheinungen und Internetkommentare. Von politisch Verantwortlichen ist dieses Bild durchaus erwünscht. Der Realität entspricht es allerdings nicht.
 © B. Schulz/Fotolia.com
© B. Schulz/Fotolia.com
Jedes Jahr im Februar gibt es wiederkehrende Freudenrufe. Denn dann, pünktlich zur Eröffnung der Biofach in Nürnberg, stellt der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) die neusten Umsatzzahlen zum Markt mit Biolebensmitteln vor. So gab es 2015 beim Umsatz ein Wachstum von 11,1 Prozent zu vermelden und für 2016 von immerhin 9,9 Prozent. Seit dem letzten Jahr wirtschaften in Deutschland zudem 8,6 Prozent mehr Betriebe ökozertifiziert. In Kombination mit den in allen Tageszeitungen abgedruckten euphorischen Statements der Vertreter der Branche und auch der politischen Prominenz bekommt man schnell das Gefühl, die Landwirtschaft sei längst ein großer romantischer Biobetrieb.
Der einzige Wehmutstropfen der „uns etwas mit Sorge begleitet“, so sagt es Clemens Neumann, Abteilungsleiter im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), ist, „dass die Produktion der Nachfrage etwas hinterherhinkt.“ Viele Bio-Produkte müssen daher noch immer aus dem Ausland importiert werden. Okay, bio ist halt nicht gleich regional. Egal. Denn wenn Aussagen von Landwirtschaftsminister Christian Schmidt dazukommen, wie „Bio und Öko ist keine Nische mehr“, oder „Bio ist zur Massenbewegung geworden“, dann wird der Eindruck geschürt, die Ernährung mit Lebensmitteln aus ökologischem Anbau sei längst esskultureller Standard.
Bio nur vermeintlich stark nachgefragt
Dabei ist das mit dem neuen Standard der bewegten Massen so eine Sache. Wie groß ist denn eigentlich der verbliebene Rest der Bevölkerung, welcher der biobewegten Masse gegenübersteht? In Deutschland sind das 95,2 Prozent. So hoch ist der Anteil der Lebensmittel, der aus konventionellem Angebot bezogen wird. Im Umkehrschluss heißt das also: Der Biomarkt in Deutschland deckt gerade einmal 4,8 Prozent des gesamten Lebensmittelumsatzes. Bei einer Bundestagswahl würde Bio also an der 5-Prozent-Hürde scheitern – nicht gerade das, was mit einer Massenbewegung assoziiert wird. Bio schrumpft aus dieser Perspektive sehr schnell von einem Scheinriesen zurück zu einem Nischenzwerg, der vielleicht kräftig und stabil, aber vor allem eins ist: nämlich klein. In anderen europäischen Ländern ist das Verhältnis noch extremer: Frankreich etwa deckt nur 2,7 Prozent seiner Lebensmittel mit Bioprodukten, Italien 2,5, Großbritannien 1,4 und Spanien 1,5 Prozent. Etwas mehr ist es in Österreich und der Schweiz mit je rund 8 Prozent. Wenn man eine ökologische Wende nicht als nationales, sondern als grenzübergreifendes Projekt betrachtet, dann scheint da doch noch einiges an internationalem Potenzial im Dornröschenschlaf zu liegen.
Wie vegan is(s)t Deutschland?
Ein anderer ernährungskommunikativer Hype, der in den letzten Jahren aufgewirbelt wurde, ist der um vegetarische beziehungsweise vegane Ernährungspraktiken. Die Thematisierung einer Ernährung, die ganz oder weitestgehend auf tierische Produkte verzichtet, ist omnipräsent. In den deutschen Großstädten tauchen immer mehr vegetarische sowie vegane Restaurants auf und das vegane Kochbuch des charismatischen Esscoachs Attila Hildmann war 2013/14 auf Platz 1 der Bestsellerliste des Kochbuchmarktes. Verlage versuchen mit unzähligen veganen Kochbüchern und diversen Veggie-Magazinen zu landen. Und steigt nicht der Umsatz mit vegetarischen und veganen Produkten beständig? Tatsächlich schoss der Umsatz mit vegetarischen Ersatzprodukten erst in die Höhe. Doch Ende 2016 kam die Ernüchterung: Nach einer Testphase ließ das Interesse schnell wieder nach.
Grüner Trend nur Luftnummer?
Unbenommen des wachsenden Angebots an Fleischalternativen, hat sich der Fleischkonsum in den letzten Jahren bei etwa 60 Kilogramm pro Kopf und Jahr ziemlich stabil eingependelt. Blickt man über die Landesgrenze in Richtung Schweiz, wo der kommunikative Bio- und Veganer-Hype ebenfalls unübersehbar ist, konnte man lesen, dass der Fleischkonsum 2013 um ein Kilo pro Kopf wieder angestiegen ist. Global ist das sowieso der Trend. Dazu passt, dass auf das vegane Lehrbuch von Hildmann sogleich Weber’s Grillbibel auf Platz 2 der Charts folgte und sich jeden Sommer aufs Neue in den Buchläden die Tische mit Grillliteratur ausbreiten. Es kauft eben nicht nur das eine Prozent der Bevölkerung Kochbücher, das sich selbst als Veganer einstuft, sondern auch die anderen 99 Prozent.
Es ließen sich zahlreiche Beispiele aufführen, warum es sich um sozio-kulinarische Fata-Morganen handelt, wenn von fleischlos-grünen Essbewegungen der Masse die Rede ist. Und ob sich der Ernährungswandel einfach sukzessive über die jüngere Generation durchsetzt, ist ebenfalls zu bezweifeln. Wissenschaftliche Studien sehen keinen Zusammenhang zwischen Alter und bio oder veganem Einkaufsverhalten. Vielmehr zählte 2014 auf Youtube ein Musikvideo über 13 Millionen Zuschauer, in dem zwei Rapper behaupten, dass „vom Salat der Bizeps schrumpft“ und fröhlich eine proteinreiche Ernährung mit Fleisch feiern. Unzählige Kommentare zum Video zeigen deutlich, dass mit dem Liedtext einer anti-vegetarischen Ernährungskultur offenbar aus dem Herzen gesprochen wird.
Die Gesellschaft für Konsumforschung weist zudem darauf hin, dass 85 Prozent der Deutschen das Fleischessen als „selbstverständlich und naturbewusst“ empfinden, 83 wollen den Fleischkonsum auch keinesfalls reduzieren und im Ernährungsreport 2017 antworteten 53 Prozent, Fleisch sei ihr Lieblingsgericht. Veggiewende? Naja.
Realität anders als Trendberichte
Es lässt sich also eine erhebliche Diskrepanz zwischen der Thematisierung von Ernährungstrends und tatsächlich umgesetzter Ernährungspraxis beobachten. Was kann man nun für eine gesellschaftswissenschaftliche Analyse daraus anbieten? Nicht alle Akteure des bio-veganen Ernährungsdiskurses haben ein ökonomisch-betriebswirtschaftliches Interesse am Boom dieser Ernährungsstile. Daher liegt der Verdacht nahe, dass hier eine Form des kommunikativen Greenwashings betrieben wird. Denn fraglos gibt es sehr wohl gute Gründe für eine Ernährung, die stärker auf Produkte aus biologischem Anbau zurückgreift. Zuvorderst wären die reduzierten Umweltkosten durch den Ökolandbau zu nennen sowie die stärker auf das Tierwohl bedachten Haltungsbedingungen. Dass das Mensch-Tier-Verhältnis in der industriellen Landwirtschaft an etlichen Stellen bedenkliche Formen angenommen hat, lässt sich kaum mehr ignorieren. Das soll nicht heißen, dass jeder konventionelle Bauer ein böser Massentierhalter ist. Aber die wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse, dass Schweine, Rinder oder Hühner nicht nur dumpfe Biomasse sind, sondern durchaus über eine weitergehende Intelligenz und kognitive Fähigkeiten verfügen, macht die Sache auch für das Selbstverständnis des Menschen als moralisch denkendes Individuum kompliziert. Für eine Ernährung mit zumindest reduziertem Fleischanteil spricht ferner, dass die Fleischproduktion sehr ressourcenintensiv und zudem gesundheitlich zweifelhaft ist. Lauter gute Gründe, doch der Wandel in der Praxis zeigt sich zäh und widerspenstig.
Müssen Lebensmittel teurer werden?
Das ist kein Wunder. Biolebensmittel sind deutlich teurer als das Angebot aus konventioneller Produktion. Nicht wenige Bio-Lobbyisten fordern daher, die Preise für konventionelle Produkte müssten die von der Gemeinschaft getragenen Kosten, beispielsweise Umweltschäden durch verunreinigtes Grundwasser, widerspiegeln und teurer werden. Das würde die Preisspanne zwischen bio und konventionell ausgleichen. Aber zum einen liegt das Preisniveau für Lebensmittel in Deutschland tatsächlich leicht über dem EU-Durchschnitt und Geld kann auch in Deutschland nur einmal ausgegeben werden.
Wer profitiert vom Greenwashing?
Es sind verschiedene soziale Gruppen, die von dem Eindruck profitieren, die vorherrschende Ernährungskultur sei bereits tierproduktfrei und nach ökologischen Kriterien organisiert. Unter anderem wären jene Zustandsbewahrer und Marktliberale wie konservative Lebensmittelhersteller, Politiker und Lobbyisten der Ernährungs- und Agrarindustrie zu nennen, die gar keinen wirklichen Ernährungswandel durchsetzen möchten. Ihr Interesse ist es, dass alles so bleibt, wie es ist und ihre Umsatzzahlen stimmen. Warum irgendwelche tiefgreifenden Veränderungen anstoßen, wenn sich doch schon alles von allein, also durch die unsichtbare Hand des Marktes regelt? Und auch die statusorientierten Milieus, die durch ihren Konsumstil mit ökologisch-zertifizierten Produkten und exquisiten Veggi-Restaurants ihr gesundheitsbezogenes Verantwortungsbewusstsein ausdrücken wollen. Sie profitieren von ihrer vermeintlichen moralischen Überlegenheit gegenüber jenen, die ihre Essgewohnheiten gar nicht ändern wollen und jenen, die es aufgrund fehlender Bildung oder eines knappen Haushaltsbudgets auch nicht können.
Mehr Bildung für nachhaltigen Ernährungsstil
Die Lösung der beschriebenen Probleme liegt keinesfalls in einer Preissteigerung für konventionell produzierte oder tierische Lebensmittel. Wollte man einen wirklichen massentauglichen Wandel der Ernährungskultur in Richtung Bio und fleischreduzierter Kost in der Bevölkerung fördern, müsste man an sehr viel schwierigeren, makropolitischen Stellschrauben drehen: der Einkommensentwicklung und der Bildung. Denn damit hängt ein reflektierter, umwelt- und gesundheitsorientierter Ernährungsstil ganz erheblich zusammen. Solange man dies aber nicht tut, sondern lieber auf den gestiegenen Konsum von Bio-Eiern verweist, während fast das gesamte Rindfleisch aus konventioneller Haltung konsumiert wird, solange handelt es sich bei dem kommunikativen Hype um Bio und vegane Ernährung um einen grünen Anstrich, den sich die Gesellschaft in Bezug auf ihre Ernährungskultur gibt. In ihrer Ernährungspraxis is(s)t sie weiterhin durch und durch konventionell – und das ist von der Politik bislang auch so gewollt.
Quelle: Kofahl D. UGBforum 5/17, S. 224-226
 Der Beitrag ist erschienen im UGBorum 5/2017
Der Beitrag ist erschienen im UGBorum 5/2017